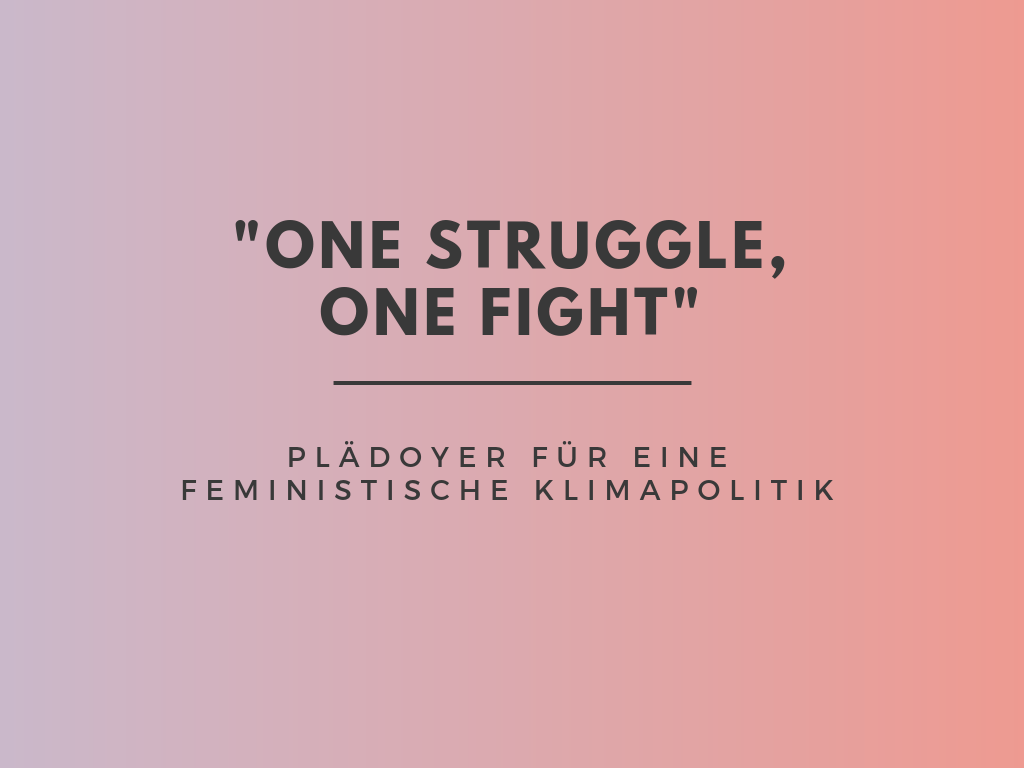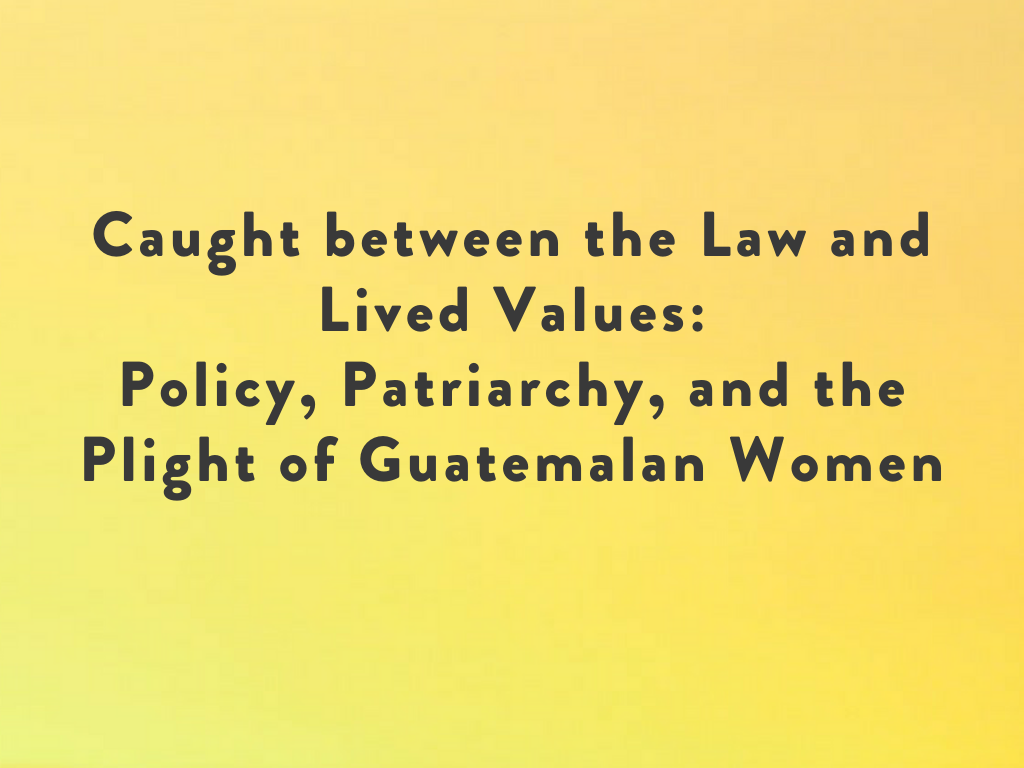Von Claudia Roth
Die Klimakrise trifft unseren gesamten Planten. Mit der Erwärmung unserer Atmosphäre um ein Grad ist sie in vielen Regionen der Welt bereits heute grausame Realität. Die Klimakrise bedeutet Dürre oder Überschwemmung, Artensterben oder den Verlust von Heimat, von jahrtausendealter Kultur. Und da Frauen und Minderheiten insbesondere im globalen Süden überdurchschnittlich unter den klimatischen Veränderungen leiden, ist die Klimakrise auch eine Krise der globalen Gerechtigkeit.
Wenn UN-Generalsekretär Antonio Guterres bei der Klimakonferenz in Katowice im Dezember 2018 von „einer Frage von Leben und Tod“ spricht, dann übertreibt er nicht, sondern macht die Dramatik des Realen deutlich: Um die Risiken einer prognostizierten „Heißzeit“ [1] wenigstens zu mindern, um das vom Weltklimarat vorgegebene 1,5-Grad-Ziel doch zu erreichen, ist sofortiges Handeln überfällig. Das Gegenteil aber passiert: Expert*innen zufolge befinden wir uns auf dem Weg zu einer Erderwärmung von durchschnittlich 3,2 Grad gegenüber vorindustrieller Zeit. Bereits 2 Grad würden ausreichen, um Staaten wie das im Pazifik liegende Tuvalu komplett verschwinden zu lassen. Steigt die Temperatur um 3 Grad, ist rund ein Fünftel des Weltkulturerbes in Gefahr [2]. Hunderte Millionen von Menschen weltweit müssten ihre Heimat verlassen. Und es sind die Entwicklungsländer, die von dieser klimabedingten Vertreibung fünf Mal mehr bedroht sind als die Industrienationen [3].
Eine Frage der globalen Gerechtigkeit
In vielfacher Hinsicht ist die Klimakrise deshalb auch eine Krise der globalen Gerechtigkeit: Während die Hauptverursacher in den Industrienationen des globalen Nordens zu suchen sind, treffen die verheerenden Auswirkungen vor allem die Länder und Gemeinschaften im globalen Süden. Dort wiederum sind besonders jene betroffen, deren Existenz auf natürlichen Ressourcen beruht und die die geringsten Möglichkeiten haben, sich vor Naturgefahren zu schützen oder auf klimatische Veränderungen zu reagieren. Frauen und Minderheiten leiden deshalb überdurchschnittlich unter den klimatischen Veränderungen: Sie stehen nicht nur größeren Risiken und Hürden gegenüber, sondern werden nicht selten durch gesellschaftliche und kulturelle Normen und Rollenbilder benachteiligt. Unter anderem haben sie einen ungleichen Zugang zu Ressourcen wie Zeit und Geld, zu Bildung und gesundheitlicher Versorgung, zu Beschäftigung und Landrechten. Zugegeben, mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens im Jahr 2015 haben die Vertragspartner das Ziel der Klimagerechtigkeit zumindest im Ansatz anerkannt. So wurde vereinbart, dass Länder mit einem großen ökologischen Fußabdruck entsprechend größere Verantwortung übernehmen und mit den Ländern des globalen Südens nach gemeinsamen Lösungen suchen. Allerdings geht es erstens bei der Umsetzung nur langsam voran. Zweitens wird es der Komplexität der anstehenden Herausforderungen nicht gerecht, dass wir die Klimakrise auch weiterhin als weitestgehend genderneutrales Phänomen begreifen. Es braucht deshalb auch in der Klimapolitik einen feministischen Ansatz: Wir müssen in der Erreichung der Pariser Klimaziele zwingend darauf achten, Ungleichheiten nicht zu verstärken, bestehende patriarchale Strukturen aufzubrechen und Diskriminierung zu verringern – hin zu einer geschlechtergerechten und damit insgesamt gerechteren Gesellschaft.
Das Patriarchat und die Klimakrise
Nehmen wir die Landwirtschaft. Für viele Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden ist die Klimakrise das drängendste Problem – die aber trifft Frauen anders als Männer. In den Regionen, die bereits heute am stärksten betroffen sind, arbeiten 70 Prozent aller Frauen in der Landwirtschaft. In Afrika stellen Frauen über 90 Prozent der Grundnahrungsmittel her. Sie sind verantwortlich für die Ernährung und Fürsorge ihrer Familien, schaffen Trinkwasser und Brennstoffe heran. Zugleich sind zwar 43 Prozent der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft weiblich, aber nur 13 Prozent der Frauen besitzen Land [4]. In Afrika gehört Frauen nur etwa 1 Prozent des Ackerlandes. Wirtschaftliche Unabhängigkeit liegt also in weiter Ferne und die Abhängigkeit steigt, wenn es wirtschaftlich schlechter läuft – beispielsweise infolge der Klimakrise. Auch extreme Wetterereignisse wirken sich nicht genderneutral aus. Bei Überschwemmungen oder Hitzewellen sterben weltweit mehr Frauen als Männer. Frauen haben schlechteren Informationszugang, erhalten somit Katastrophenwarnungen später. Die traditionelle Rollenaufteilung bewirkt zudem, dass Frauen häufiger zu Hause sind und sich um Kinder und Angehörige kümmern. Und natürlich können Frauen mit Kindern, Alte oder Schwangere schlechter fliehen. Ein weiterer Aspekt: Die Klimakrise verlängert die Dürreperioden – und das gefährdet die Nahrungssicherheit. Dürren haben zudem zur Folge, dass Frauen zusätzliche Zeit auf den Feldern verbringen müssen. Dies nimmt ihnen wiederum die Möglichkeit zu Bildung, weiterer Lohnarbeit oder politischer Partizipation. Die längeren Wege, die Frauen gehen müssen, um Wasser oder Brennmaterial zu beschaffen, erhöhen schließlich die Gefahr sexueller Belästigung, von Überfällen und Vergewaltigung. Und wer bleibt in den unterversorgten Regionen zurück, wenn insbesondere Männer infolge von Dürren, der Versalzung der Böden oder des steigenden Meeresspiegels ihre Heimat verlassen? Frauen, gemeinsam mit den wachsenden sozioökonomischen Herausforderungen.
Ein intersektional-feministischer Blick
All das zeigt: Frauen, aber auch Kinder und Ältere tragen heute die Hauptlast der Klimakrise auf ihren Schultern. Dasselbe gilt für politisch marginalisierte Gruppen: Schätzungen zufolge sind bereits 150 Millionen Indigene von den Folgen des Klimawandels betroffen. Sehr häufig leben sie in sensiblen Ökosystemen wie kleinen Inselstaaten oder Atollen im Pazifik, in tropischen Regenwäldern, in arktischen Regionen, im Hochland der Anden und des Himalaya oder in den Wüstengebieten Afrikas; in Lebenswelten also, die heftiger betroffen sind als andere – von der Klimakrise, aber auch von einem globalen System extensiven Wachstumskapitalismus. So leben im brasilianischen Amazonasgebiet fast 400 indigene Völker, die auf das intakte Ökosystem ökonomisch und kulturell angewiesen sind [5]. Dem gegenüber steht die Agroindustrie, die jedes Jahr tausende Quadratkilometer Regenwald abholzt. Da passt es ins Bild, dass der neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro gleich zu Beginn seiner Amtszeit die Verantwortung für die indigenen Schutzgebiete im Regenwald an das Landwirtschaftsministerium übertrug – und damit an eine Behörde, die massiv auf die landwirtschaftliche Nutzung der Gebiete drängt. Feministische Klimapolitik sollte deshalb stets auch intersektional sein: Natürlich muss sie die besondere Situation von Frauen und Mädchen, zugleich aber auch die Belange marginalisierter Gruppen ins Auge fassen – und schließlich die herausragende Rolle all dieser Akteur*innen nutzen. Im Umkehrschluss nämlich stimmt doch auch: Gerade weil Frauen und marginalisierte Gruppen auf besondere Weise von der Klimakrise betroffen sind, kommt ihnen eine Schlüsselfunktion in der Bewältigung zu. Allein durch ihre Lebenssituation sind sie Expert*innen für die Anpassung an den Klimawandel, sind sie die natürlichen Gestalter*innen eines nachhaltigen Wandels. Eine gleichberechtigte, gendergerechte Gesellschaft hat deshalb bessere Aussichten, ihre Umwelt zu schützen und die Klimakrise zu überwinden. Je geschlechtergerechter eine Gesellschaft, desto kleiner der CO2-Fußabdruck pro Person – das beweisen erste Studien. Das bedeutet dann aber auch: Wenn wir nicht umgehe
nd mit einer geschlechtergerechten Klimapolitik umsteuern und Ungleichheiten beenden, werden die Auswirkungen der Klimakrise die strukturelle Diskriminierung nur verstärken.
Noch immer ist die Gleichberechtigung aller Geschlechter weltweit nicht erreicht. Dabei hat sich die Weltgemeinschaft bereits vor 70 Jahren in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zur Universalität, Unveräußerlichkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und damit zur Gleichheit aller Menschen bekannt. Die Überwindung von Gewalt und Diskriminierung sowie die Stärkung von Frauen, Mädchen und marginalisierten Gruppen ist seither nicht nur eine elementare Frage der Gerechtigkeit, sondern fester Bestandteil der konsequenten Verwirklichung der universellen Menschenrechte. Im Jahr 1995 wurde auf der vierten Weltfrauenkonferenz in Peking klar und deutlich formuliert, dass Frauenrechte auch Menschenrechte sind. Vor allem aber wurde offiziell der Zusammenhang zwischen Gender, Umwelt und nachhaltiger Entwicklung anerkannt. Dennoch werden Klimakrise und Klimapolitik von vielen bis heute als geschlechtsneutral betrachtet.
Keine Klimagerechtigkeit ohne Gendergerechtigkeit
Weder die Klimarahmenkonvention von 1992 noch das Kyoto-Protokoll von 1997 enthalten Referenzen zu Gender oder Frauen. Erst seit 2012 ist „Gender und Klima“ als fester Punkt auf der Tagesordnung der Klimakonferenzen verankert; zudem wurden weitergehende Vereinbarungen zur Geschlechterparität in Delegationen, Verhandlungsgruppen und Konsultationsmechanismen vereinbart. Auf der COP23 in Bonn im Jahre 2017 beschloss die Staatengemeinschaft zudem einen Genderaktionsplan. Konkret bedeutet das: Die Genderperspektive muss in sämtlichen klimapolitischen Bereichen und Maßnahmen, insbesondere in den Nationalen Aktionsplänen verankert – und als Gesamtvorhaben langfristig in der Klimafinanzierung unterfüttert werden. Die Klimakrise ist nicht genderneutral; die Finanzierungsinstrumente dürfen daher auch nicht genderblind sein. Auch der Kriminalisierung von Menschenrechts- und Umweltaktivist*innen und Frauenrechtler*innen weltweit ist aktiv entgegenzutreten. Eine Umsetzung des Genderaktionsplanes bedeutet auch, Frauen und marginalisierte Gruppen auf allen Machtebenen klimapolitischer Organisationen und in Entscheidungsgremien mindestens gleichberechtigt zu repräsentieren. In allen Prozessen der Klimapolitik müssen Frauen und marginalisierte Gruppen als Expert*innen paritätisch einbezogen und ihre Schlüsselrolle in der Bekämpfung der Klimakrise anerkannt werden.
Ein weiter Weg
Nicht zuletzt das Ringen um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens auf der Klimakonferenz in Katowice hat gezeigt: Der Weg ist noch weit – aus feministischer ebenso wie aus klimapolitischer Perspektive. Neben der gefühlten Omnipräsenz lautstarker Klimaleugner wie Donald Trump und Jair Bolsonaro stellten Vertragsstaaten die (längst unleugbaren) wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel oder das 1,5-Grad-Ziel des IPCC-Berichtes infrage. Kaum verwunderlich, dass das Ergebnis der wochenlangen und bisweilen schweißtreibenden Verhandlungen enttäuschend ausfiel. So ist es in Katowice fatalerweise nicht gelungen, Bezüge zu Menschenrechten aus der Präambel des Pariser Klimaabkommens auch im Regelwerk zu verankern. Immerhin: Dank dem harten Verhandeln der „Women & Gender Constituency“ sowie der konsequenten und lauten Lobbyarbeit von Organisationen wie „GenderCC – Women for Climate Justice“ wurde festgelegt, dass Gendergerechtigkeit für Planungsprozesse der national festgelegten Beiträge und in den Berichten zu Anpassungsmaßnahmen verankert wird, und dass auch gendergerechte Technologie- und Innovationsansätze anerkannt werden [6]. Zudem wurde die Schaffung einer Plattform lokaler Gemeinschaften und indigener Völker vereinbart, wodurch ihre Vertreter*innen die gleiche Anzahl an Sitzen einnehmen wie die Vertragsstaaten. Damit die nächste Klimakonferenz aber endlich der Dramatik der anstehenden Herausforderungen gerecht wird, braucht es – gerade angesichts jüngster wissenschaftlicher Erkenntnisse über das rapide Voranschreiten der Klimakrise – ein grundlegendes Umdenken. Deutschland, einst klimapolitischer Vorreiter, muss endlich aufhören, zu bremsen, und mit Nachdruck für einen echten und zugleich intersektional-feministischen europäischen Klimaschutz eintreten. Denn: Für eine wirkungsvollere Gestaltung nationaler und internationaler Klimapolitik ist und bleibt die Gleichberechtigung von Frauen und marginalisierten Gruppen entscheidend. Die feministische Bewegung hat in Katowice gezeigt, wie stark sie ist, wenn nicht nur Frauen, sondern die gesamte Zivilgesellschaft solidarisch und intersektional zusammensteht. „One struggle, one fight“ – das muss das Motto sein in einem Jahr 2019, das nicht zuletzt für die Bekämpfung der Klimakrise entscheidend sein wird. Der Einsatz für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen, für ein gutes Leben aller im Rahmen der planetaren Grenzen ist eben nicht nur ein klimapolitischer: Er richtet sich stets auch gegen patriarchale Ausbeutungsstrukturen.
This article has been originally published by WeltTrends e.V. in its 149 edition on Feminist Foreign Policy.
Claudia Roth geb. 1955, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und seit 1998 MdB für Bündnis 90 / Die Grünen, u. a. von 2003 bis 2004 Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik. Von 2001 bis 2013 war sie Vorsitzende ihrer Partei.
[1] Vgl.: Schellnhuber, Hans-Joachim et al.: Trajectories of the Earth System on the Anthropocene. In: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 6.8.2018.
[2] Vlg. Marzeion, Ben / Levermann, Anders: Loss of Cultural World Heritage and Currently Inhabited Places to Sea-Level Rise. In: IOP Science, 4.3.2014
[3] Vgl. Oxfam (2017): Uprooted by Climate Change – Responding to the Growing Risk of Climate Displacement.
[4] Vgl. Welthungerhilfe: Fact Sheet: Frauen und Entwicklung. In: Welthungerhilfe, 2018.
[5] Vgl. https://amazonwatch.org/.
[6] Vgl. Rojas, Ana: Advancing Gender Equality, Women’s Empowerment and Indigenous Rights from COP24 to COP25 through the Paris Rulebook. In: ICUN, 21.12.2018.